Deutsche Märzrevolution (1848)
1. Ein Schuster im deutschen Vormärz

Der Schuster Hermann Friedrich zieht seinen Kittel zurecht, als er den staubigen Weg zum Hambacher Schloss hinaufsteigt. Er ist vier Tage unterwegs gewesen, um hierher zu kommen. Die Sonne brennt heiß auf das Land, doch die Menschen, die sich ringsum versammelt haben, stören sich nicht daran. Männer und Frauen, Studenten und Handwerker, Bürger und Adelige – sie alle strömen nach oben, die schwarz-rot-goldenen Fahnen wehen im Wind. Hermanns Herz schlägt schneller. Schon seit Wochen hat er von diesem Fest gehört, von der Versammlung der freien Geister, von den Reden, die hier gehalten werden sollen. Nun ist er selbst mittendrin. Ein älterer Herr mit buschigem Schnurrbart reicht ihm die Hand. „Zum ersten Mal hier, junger Mann?” Hermann nickt eifrig. „Ja, ich komme aus Frankfurt. Wir haben in den Werkstätten viel über das Fest gesprochen. Aber dass ich es wirklich erlebe …” Der Mann lacht. „Dann wirst du sehen, was es heißt, ein Deutscher zu sein.” Ein Ruck geht durch die Menge. Stimmen schallen über den Platz, als Redner nacheinander auf die improvisierte Bühne treten. Hermann drängt sich näher, um zu hören. Ein Mann mit durchdringendem Blick spricht von Freiheit, von Einheit, von der Notwendigkeit, Deutschland nicht länger gespalten zu lassen. „Aber was für ein Deutschland?” ruft ein Student neben Hermann. „Ein Kleindeutschland unter Preußen oder ein großes, geeintes Reich mit Österreich?” Hermann überlegt. Er hat gehört, dass die einen Preußen fürchten, dass andere Österreich als zu konservativ ansehen. Die Frage brennt in ihm. Kleindeutsch oder großdeutsch? Ein anderer Redner tritt vor, hebt die Stimme: „Das Volk wird entscheiden! Nicht die Fürsten, nicht die Fremden! Deutschland muss erwachen!” Die Menge tobt. Hermann spürt, wie sein Herz mit dem Rufen der Menschen verschmilzt. Er hat geglaubt, nur ein Schuster zu sein – doch jetzt fühlt er sich als etwas Größeres: als ein Teil dieses Deutschlands, das hier geboren wird.
2. Der Schustergeselle und die Revolution

Sechzehn Jahre später. Der junge Schustergeselle Johann spürt den Matsch durch die Löcher in seinen Stiefeln dringen. Der Winter ist mild gewesen, doch der Frühling bringt nur Regen, und der Himmel hängt grau und schwer über Frankfurt. Seine Finger sind rissig vom Leder, seine Augen müde vom langen Arbeiten in der Werkstatt. Die Kundschaft wird weniger, das Geld reicht kaum. Aus seines Vaters Erzählungen kennt er die Sehnsucht nach Freiheit und das Gefühl der Einigkeit, damals auf dem Wartburgfest, und später dann beim Hambacher Fest. Heute spricht sein Meister oft davon, dass sich etwas ändern muss, dass es so nicht weitergehen kann. „Die Steuern, Johann! Die verdammten Steuern! Und wer bezahlt sie? Wir! Die Herren da oben lachen nur.” Johann weiß, dass der Meister recht hat. Die Preise steigen, das Brot wird teurer, aber der Lohn bleibt gering. Er hofft, irgendwann seine eigene Werkstatt zu eröffnen, doch mit jedem Tag scheint dieser Traum weiter in die Ferne zu rücken. An den Abenden versammeln sich die Gesellen in den Wirtshäusern und sprechen von Freiheit, von Rechten, von der Notwendigkeit, sich zu wehren. Johann hört zu. Er hört von Paris, wo das Volk im Februar den König gestürzt hat, von Wien, wo Barrikaden errichtet worden sind. Auch in Frankfurt beginnen die Menschen, sich zu rühren. Dann, im März, kommt die Nachricht: Die Revolution hat Berlin erreicht! Es heißt, Arbeiter und Bürger hätten sich gegen das Militär erhoben, die Soldaten schießen, aber die Menschen geben nicht nach. „Nun, Johann?”, fragt ein Freund in der Werkstatt. „Wirst du auch mit uns auf die Straße gehen?” Johann zögert. Was, wenn sie ihn verhaften? Wenn er seine Anstellung verliert? Doch dann denkt er an seine durchgelaufenen Stiefel, an das Brot, das er sich kaum leisten kann. An das Unrecht, das er jeden Tag sieht.
Die Glocken der Paulskirche dröhnen über das Häusermeer Frankfurts. Die Menge auf dem Römerberg drängt sich dicht aneinander, Stimmen erheben sich, rufen Namen, fordern Freiheit. Jakob Mayer, ein Handwerker aus Mainz, steht auf den Zehenspitzen, um besser sehen zu können. Sein Hemd ist von der Hitze des späten Mai feucht, die Ärmel hochgekrempelt, die Hände rußverschmiert von der Arbeit – oder von der Revolution. „Jetzt schreiben sie Geschichte, Jakob!”, ruft ihm Wilhelm zu, sein alter Freund aus der Kindheit. „Die ersten freien Männer unseres Vaterlandes treten zusammen!” Jakob nickt. Er weiß nicht, ob er an eine geeinte deutsche Nation glauben kann. Doch das Wort „Freiheit” hat ihn gepackt. Seit Wochen ist die Stadt in Aufruhr, Gerüchte über ein deutsches Parlament verbreiten sich. Und nun, am 18. Mai 1848, sind sie wirklich hier – die Männer, die ein neues Deutschland formen sollen. Mit einem Schubs drängt ihn Wilhelm weiter zur Kirche. „Wir müssen rein, wenigstens in den Vorraum!” Drinnen ist es kühler, aber nicht weniger voller. Männer stehen Schulter an Schulter, riechen nach Leder, Tabak und Aufbruch. Jakob versucht, die Redner zu erkennen. Auf der Empore sitzen Professoren, Juristen, Offiziere – keine Handwerker, keine Arbeiter. Dennoch jubelt die Menge, als der greise Heinrich von Gagern die Sitzung eröffnet. „Das deutsche Volk erhebt sich in Einigkeit!”, ruft Gagern. Ein Brausen geht durch die Kirche. Jakob spürt, wie sein Herz schneller schlägt. Ist das nun Freiheit? Ist das die Zukunft? Doch in seinem Kopf hallt auch die Frage nach: Wird dieses Parlament die einfachen Leute wirklich vertreten – oder ist es nur eine Versammlung der feinen Herren?
3. Grundrechte für alle?
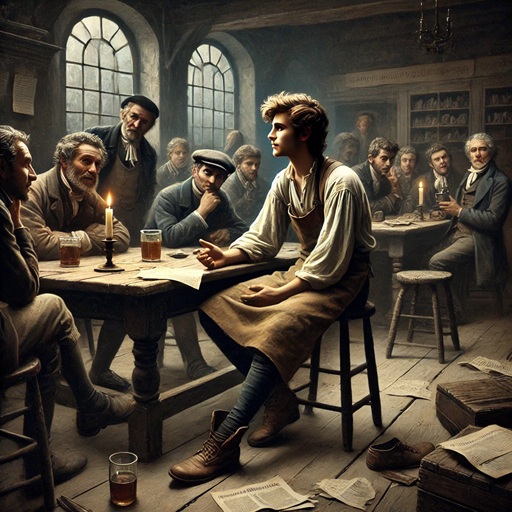
Johann drängt sich durch die Menge vor der Paulskirche. Seine Stiefel hinterlassen nasse Abdrücke auf den Steinstufen. Die Luft ist stickig, getränkt von Schweiß und Erwartung. Männer stehen dicht an dicht, murmelnd, tuschelnd, manche mit verschränkten Armen, andere mit erhobenen Fäusten. Drinnen hallen Stimmen von den hohen Mauern wider. Die Abgeordneten debattieren über die neue Verfassung, über Grundrechte, die Johann kaum zu hoffen wagte. Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Gleichheit vor dem Gesetz – große Worte, die sich wie ein Versprechen in seine Brust graben. Er steht im Vorraum, lässt sich von den Gesprächen um ihn herum tragen. "Hört ihr das?" Ein Mann neben ihm, ein Tischlergeselle, lehnt sich vor. "Sie sprechen davon, dass alle Menschen gleich sein sollen vor dem Gesetz! Keine Sonderrechte mehr für die Adligen!" Johann nickt langsam. Wie oft hat er erlebt, dass sein Meister bei Streitigkeiten mit wohlhabenden Kunden den Kürzeren zog? Dass ein einfacher Handwerker nie Recht bekam, wenn ein Kaufmann oder gar ein Beamter gegen ihn stand? Wenn die Worte, die dort drinnen gesprochen werden, Realität würden, wäre das ein neues Deutschland. Doch nicht alle sind überzeugt. Ein alter Mann, mit grauem Bart und fleckiger Weste, schnaubt. "Worte, nur Worte! Freiheit auf Papier hilft uns nichts, wenn die Fürsten ihre Soldaten schicken!" Ein Raunen geht durch die Versammelten. Drinnen erheben sich die Stimmen der Abgeordneten, die hitzig über die Staatsform streiten. Soll Deutschland eine konstitutionelle Monarchie werden oder eine Republik? Johann spürt, wie ihm der Atem stockt. Das ist der Kern der Revolution. Würde es ein Deutschland mit einem gewählten Parlament geben, mit einem König, der an eine Verfassung gebunden wäre? Oder würden sie sich gar von den Monarchen befreien? "Die Republik ist ein Traum!" Ein Herr mit Zylinder tritt aus der Kirche, während er seine Notizen einsteckt. "Die Mehrheit wird eine konstitutionelle Monarchie wählen. Ein Kaiser muss an der Spitze stehen, sonst zerfällt Deutschland in seine Kleinstaaterei!" Johann ballt die Fäuste. Eine Monarchie, wenn auch mit Verfassung – ist das nicht ein Kompromiss, der zu wenig verspricht? "Und was, wenn der König sich weigert?" fragt er laut. "Wenn er die Verfassung nicht anerkennt? Dann bleibt alles beim Alten!" Der Mann mit dem Zylinder lächelt müde. "Dann, junger Freund, wird sich zeigen, wie stark die Revolution wirklich ist." Johann senkt den Blick. Er hat das Blut auf den Straßen gesehen, hat die Toten des Septemberaufstandes nicht vergessen. Die Revolution hat so viel Hoffnung gebracht – doch die Macht liegt noch immer in den Händen der Könige. Wird eine Verfassung genügen, um das zu ändern? Als er wieder auf die Straße tritt, brennen die Gespräche in seinem Kopf nach. Die Entscheidung wird bald fallen. Wird Deutschland ein neues Zeitalter betreten, oder wird alles, wofür sie gekämpft haben, vergeblich sein?
4. Die alten Mächte formieren sich

Der Geruch von nassem Leder und heißem Pech füllt die Luft. Es ist spät, doch Johanns Hände sind rastlos. Seine Finger tasten über die aufgerauten Nähte eines Stiefels, aber sein Kopf ist nicht bei der Arbeit. Die Gespräche auf der Straße hallen in seinen Gedanken nach, und er kann das Gefühl nicht abschütteln, dass sich etwas zusammenbraut. Am nächsten Morgen zieht es ihn auf den Markt. Er will Brot kaufen, doch sein Blick bleibt an einer kleinen Gruppe von Soldaten hängen, die unter den Arkaden eines Hauses stehen. Sie reden leise, doch ihre Stimmen sind scharf wie Messer. Er tritt näher, setzt sich auf eine umgestürzte Kiste und tut, als würde er die Tagesnachrichten auf einem zerknitterten Flugblatt studieren. „Die Herren in der Paulskirche glauben wohl, sie hätten das Sagen”, sagt ein junger Offizier mit schmalem Gesicht und einem dünnen Schnurrbart. „Aber ohne eine eigene Armee können sie nichts durchsetzen.” Ein älterer Soldat mit wettergegerbtem Gesicht lacht trocken. „Die Abgeordneten schwafeln von Freiheit, von Rechten für das Volk – aber am Ende wird getan, was der König sagt. Ohne Preußen und Österreich sind sie machtlos.” „Und beides sind Monarchien”, fügt ein dritter hinzu, seine Stimme mit Spott durchtränkt. „Glaubst du wirklich, die Habsburger oder der preußische König werden sich von ein paar Professoren und Anwälten vorschreiben lassen, wie sie ihr Reich zu führen haben?” Johanns Magen zieht sich zusammen. Er weiß, dass die Nationalversammlung keine eigene Exekutive besitzt, dass sie auf die Kooperation der Fürsten angewiesen ist. Aber bisher hat er gehofft, dass sich die neuen Ideen durchsetzen könnten. Dass Preußen und Österreich den Willen des Volkes anerkennen würden. „Der König von Preußen wird die Kaiserkrone ablehnen”, murmelt der Offizier. „Er wird sie nicht aus der Hand eines Parlaments annehmen. Das ist gegen seine Ehre. Die Abgeordneten haben sich in eine Sackgasse manövriert.” Johann spürt, wie sich seine Miene verfinstert. Also ist es das? Ein großes Schauspiel, das am Ende doch nur mit einer Verneigung vor der alten Ordnung endet? Sein Herz pocht, als er sich langsam erhebt. Er kann nicht mehr zuhören. Mit schnellen Schritten verlässt er den Platz, ohne sich noch einmal umzusehen. Die Gespräche der Soldaten brennen in seinem Kopf nach, und mit jedem Schritt wächst die Wut in ihm. Wenn die Revolution an den Fürsten scheitert – was bleibt dann noch?
5. Die eiserne Faust der Allianz

Johann sitzt mit seinen Freunden in einer dunklen Ecke des Wirtshauses. Der Raum ist erfüllt vom Dunst des Pfeifenrauchs und dem dumpfen Murmeln aufgeregter Stimmen. Draußen in den Gassen Frankfurts hat sich die Lage wieder beruhigt, aber die Unzufriedenheit bleibt. Der Aufstand vom September hat gezeigt, dass die Kräfte der alten Ordnung nicht so einfach zu stürzen sind. „Paris, Wien, Berlin – überall sind die Menschen aufgestanden, aber was ist geblieben?”, fragt sein Freund Karl und stößt seinen leeren Bierkrug hart auf den Tisch. „Die Monarchen haben sich erholt. Die Revolution ist tot.” „Nicht tot”, widerspricht Johann. „Unterdrückt vielleicht. Aber sie wird wiederkommen. Schau nach Frankreich – sie haben ihre zweite Republik. In Italien kämpfen sie noch immer gegen die Fürsten. In Ungarn rebelliert das Volk gegen die Habsburger. Die Welt ist in Bewegung!” Karl schüttelt den Kopf. „Frankreich hat zwar eine Republik, aber was nützt sie uns hier? Und in Wien hat das Militär die Stadt wieder unter Kontrolle gebracht. Die Preußen haben in Berlin ihre Kanonen sprechen lassen. Selbst in Baden, wo die Liberalen am stärksten waren, bröckelt der Widerstand. Was bleibt uns? Die Nationalversammlung hat schöne Reden gehalten, aber sie hatten keine Macht. Die Fürsten haben ihre Soldaten, wir nur unsere Worte.” Johann denkt an die letzten Monate. Er erinnert sich an die Euphorie des Frühlings, an die Hoffnung, dass sich alles ändern könnte. Die Nationalversammlung in der Paulskirche hat über eine neue Verfassung beraten, über Grundrechte, über eine geeinte deutsche Nation. Doch während sie diskutieren, sammeln die Könige und Fürsten ihre Armeen. Die Träume von Freiheit prallen gegen Bajonette. Johann steht auf dem Marktplatz von Frankfurt. Es riecht nach Rauch. Nach verbrannten Flugblättern, nach Angst. Die Soldaten der Allianz marschieren durch die Stadt, die Gewehre geschultert, die Bajonette blitzen im frühen Morgenlicht. Ihre Stiefel hallen auf dem Pflaster wider, als sie vor dem Rathaus Aufstellung nehmen. Der Offizier hebt die Hand, gibt ein Zeichen – und die Männer reißen die schwarz-rot-goldene Fahne herunter, die rebellische Bürger dort gehisst hatten. Johanns Hände ballen sich zu Fäusten. Er weiß, was kommt. Die Revolution, die Hoffnungen des Hambacher Festes, all das, was sie in jenen Tagen geschworen haben – es ist vorbei. Die Heilige Allianz hat zugeschlagen. Die Fürsten, die Könige, der Kaiser von Österreich, der Zar in Russland – sie dulden keinen Aufstand. Sie fürchten die Freiheit des Volkes mehr als jeden Feind von außen. „Johann!” Eine Stimme reißt ihn aus seinen Gedanken. Es ist Karl, sein Freund aus der Werkstatt, das Gesicht bleich, die Augen voller Unruhe. „Sie haben Ludwig und die anderen verhaftet. Sie sagen, sie hätten konspirative Schriften verteilt.” Johann flucht. Ludwig war einer der ersten, der in Frankfurt von Freiheit gesprochen hat. Jetzt wird er in einem dunklen Kellerloch verschwinden. Oder Schlimmeres. Ein Soldat wirft einen Stapel Flugblätter ins Feuer. Die Papierbögen kräuseln sich, schwarze Fetzen steigen auf, verwehen im Wind. „Die Revolution stirbt, Johann,” sagt Karl leise. Johann schüttelt den Kopf. „Nein, Karl. Sie schläft nur. Und eines Tages wird sie erwachen.” Doch als die Soldaten weiterziehen und der Rauch der verbrannten Hoffnung über den Marktplatz zieht, fühlt er zum ersten Mal die bittere Kälte der Niederlage.
6. Der stille Rückzug
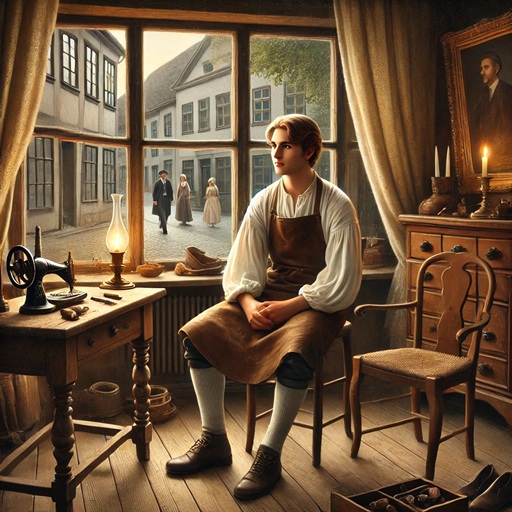
In seiner Werkstatt zieht Johann den Pechfaden durch das Leder. Die Nadel gleitet durch das Material, seine Hände arbeiten mechanisch, ohne dass sein Kopf noch viel nachdenkt. Er weiß, was er tut – und das ist es, was jetzt zählt. Arbeiten. Schweigen. Sich heraushalten. Auf der Straße vor seiner Werkstatt lachen Kinder. Frauen in geblümten Kleidern schlendern über das Pflaster, Männer mit hochgeschlagenen Kragen diskutieren über Mode, Geschäfte und das neueste Klavierstück eines gewissen Herrn Schumann. Aber niemand spricht mehr über Freiheit. Niemand spricht mehr über Deutschland. Johann hat es kommen sehen. Seit die Fürsten mit eiserner Faust durch das Land gezogen sind, ist die Angst gewachsen – und mit ihr die Gleichgültigkeit. Die Bürger wenden sich ab. Sie richten sich in ihrem Leben ein, im Salon, in der Familie, in der Musik. Politik? Was nützt das noch? „Du grübelst schon wieder, Johann.” Er blickt auf. Karl steht in der Tür, seine Schürze über die Schulter geworfen, ein müdes Lächeln im Gesicht. „Ich frage mich nur … war das alles umsonst?” Karl setzt sich, zieht ein Messer aus der Tasche und beginnt, einen Holzspan zu schnitzen. „Ich war neulich in Frankfurt,” sagt er nach einer Weile. „Die Leute dort reden von Geschäften, von Kunst, von Reisen nach Italien. Niemand will noch von Hambach hören oder von den Gefangenen in den Kerkern der Fürsten.” „Also haben sie gewonnen.” Karl zuckt die Schultern. „Nein, Johann. Die Leute leben einfach weiter. Sie richten sich ein. Vielleicht ist das klüger, als immer gegen Wände zu rennen.” Johann blickt auf seine Hände, auf die Schuhsohle, die er flickt. Ein solider Schuh. Für einen Bürger, der spazieren gehen wird, der sich nicht sorgt, nicht kämpft, nicht träumt. Er seufzt. „Vielleicht hast du recht.” Draußen spielt jemand eine sanfte Melodie auf der Violine. Eine schöne, harmlose Melodie. Johann zieht den Faden fester. Ja, eines Tages würden sie ihre Rechte bekommen und niemand würde sie ihnen je wieder wegnehmen.