Preußische Reformen
1. Der letzte Sommer auf dem alten Gut Falkenstein

Ich heiße Albrecht, Graf von Falkenstein, und ich bin 17 Jahre alt. Mein Vater starb früh, und so wurde ich schon als Junge Herr über unser Gut. Falkenstein liegt in den weiten Feldern Ostpreußens, wo der Wind über das Getreide streicht und die Sonne über endlosen Wiesen steht. Meine Nachbarn – die anderen Grafen, Freiherren und Barone – sehen in mir nur den Jungen mit dem alten Namen. Für sie bin ich ein Fremder in ihrer Welt, obwohl ich einer von ihnen bin. Doch ich denke nicht wie sie. Ich sehe, wie sie leben: in ihren Schlössern voller Spiegel und Diener, während draußen die Bauern sich die Hände wund schuften. Sie feiern Bälle, während Kinder hungrig schlafen gehen. Sie nennen das „Tradition”. Ich nenne es Unrecht. Im letzten Sommer entschied ich, dass sich etwas ändern muss. Ich ließ die Pacht halbieren. Die Bauern staunten, als ich selbst mit der Sense aufs Feld kam. Ich lernte von ihnen, wie man pflügt, sät und erntet. Meine Hände wurden rau, meine Schultern schwer – doch mein Herz war leicht. „Ein Graf gehört aufs Pferd, nicht auf den Acker!”, spottete Baron von Rabenhorst bei einem Jagdfrühstück. Ich antwortete: „Ein echter Herrscher kennt die Last seines Volkes.” Manche sagten, ich sei verrückt geworden. Doch immer mehr junge Adlige kamen heimlich zu mir, wollten wissen, wie man eine Schule gründet, wie man Gärten für alle anlegt, wie man das Land besser nutzt, ohne Menschen zu quälen. Wir nannten uns den neuen Adel. Nicht geboren, um zu herrschen – sondern, um zu dienen. In jenem Herbst stand ich auf dem alten Wehrturm unseres Guts, sah über die goldenen Felder, und wusste: Das Preußen, das kommt, wird nicht mehr das Preußen der Peitsche sein, sondern das des Pflugs. Ich bin Albrecht von Falkenstein. Und dies ist nicht das Ende der Geschichte – sondern ihr Anfang.
2. Leibeigen geboren, leibeigen gestorben
Erzählt von Albrecht, Graf von Falkenstein

Ich war zwölf Jahre alt, als der König das sogenannte Oktoberedikt erließ. Es war ein Papier mit vielen Stempeln und Siegeln, unterzeichnet von Staatsmännern, die ich nur aus Porträts kannte. Doch was dort geschrieben stand, war nichts Geringeres als ein Donnerschlag:
„Die Leibeigenschaft ist abgeschafft.”
Ich erinnere mich an den Tag, als mein Hauslehrer mir die Nachricht überbrachte. Wir saßen in der Bibliothek, zwischen Büchern, die ich kaum zu lesen verstand, und er sagte mit ernster Stimme: „Ab heute sind die Bauern freie Menschen, Albrecht. Sie gehören niemandem mehr.” Ich wusste nicht, ob ich mich freuen oder fürchten sollte. Ich war jung, aber ich hatte Augen im Kopf. Ich sah, wie die Männer auf unseren Feldern schuften mussten, bei Regen und Frost, ohne Klage. Ich sah die Frauen, die kaum sprechen durften, wenn ein Aufseher in der Nähe war. Und ich hörte, wie nachts mein Verwalter mit der Peitsche drohte, wenn jemand zu spät ablieferte. Und nun – sollten all diese Menschen frei sein?
Die Nachricht verbreitete sich schnell. Im Dorf unterhalb des Schlosses versammelten sich die Bauern auf dem kleinen Platz vor dem Backhaus. Ich ging heimlich dorthin, mit einem alten Mantel und Mütze, um nicht erkannt zu werden. Ein alter Mann, Martin hieß er, der schon unter meinem Großvater gearbeitet hatte, sprach laut: „Frei? Was nützt uns Freiheit, wenn wir kein Stück Erde besitzen?” Und eine Frau, Grete mit den roten Haaren, rief: „Wird der Graf uns nun vertreiben oder lässt er uns bleiben?” Ich schämte mich in diesem Moment. Nicht für mich, sondern für all die Generationen vor mir, die geglaubt hatten, Menschen könnten Besitz sein – wie ein Pferd oder ein Pflug. In den Wochen danach bat ich meinen Vormund, mir alle Pachtverträge zu zeigen. Ich las jede Zeile. Viele Bauern durften zwar bleiben, aber zu so hohen Abgaben, dass ihnen kaum etwas übrig blieb. Ich traf eine Entscheidung. Gegen den Rat meiner Berater, gegen das Murmeln der Nachbarn. Ich ließ unsere Bauern versammeln und sagte ihnen, dass sie ihr Land behalten dürften – gegen einen geringen Kaufpreis, zahlbar über viele Jahre. Ich sah Tränen in Augen, die sonst nur hartes Wetter und mühsame Arbeit kannten. Ein junger Mann, Wilhelm, der gerade Vater geworden war, kniete sich vor mir nieder. Ich hob ihn hoch. „Ein freier Mann kniet vor niemandem,” sagte ich. „Auch nicht vor einem Grafen.” Doch nicht alle hatten Glück. Manche Bauern hatten zu wenig Land, um davon leben zu können. Andere hatten gar kein Land, nur ihre Arbeitskraft. Sie zogen in die Städte, suchten ihr Glück als Tagelöhner in Berlin oder Königsberg. Ich erinnere mich an Johanna, ein kluges Mädchen mit großen braunen Augen. Ihre Familie war zu arm, um das Land zu kaufen. Ich schrieb ihr einen Brief, gab ihr etwas Geld für die Reise nach Breslau, wo sie eine Lehre als Weberin beginnen wollte. Sie schrieb mir später zurück: „Lieber Herr Graf, ich bin nicht reich, aber ich bin frei. Und das ist mehr, als meine Mutter je war.”
Meine Nachbarn sahen mein Handeln mit Misstrauen. Baron von Rabenhorst schickte mir einen Brief, in dem stand: „Ein Graf ist kein Wohltäter. Wer den Bauern zu viel gibt, verliert seinen Stand.” Ich antwortete nicht. Aber ich ließ eine neue Scheune bauen – gemeinsam mit den Bauern. Auf dem Balken über dem Tor steht bis heute: „Ehre dem, der arbeitet – nicht dem, der befiehlt.”
Die Bauernbefreiung war nicht perfekt. Sie schuf neue Ungleichheiten, neue Probleme. Doch sie war ein Schritt – ein mächtiger, mutiger Schritt – hin zu einem gerechteren Land. Ich sehe heute junge Burschen auf ihren eigenen Äckern stehen. Ich sehe ihre Kinder in der Dorfschule, lesend und schreibend. Und ich weiß: Freiheit beginnt nicht in Gesetzen, sondern in Köpfen – und in Herzen. Und wenn sie mich eines Tages fragen, was ich als junger Graf getan habe, dann werde ich sagen:
Ich habe begonnen, zuzuhören. Ich habe begonnen, zu handeln. Und ich habe geholfen, die Ketten zu lösen, die Jahrhunderte gehalten hatten.
3. Wissen für alle – Die Schulstube auf dem Hügel
Erzählt von Albrecht, Graf von Falkenstein

Es begann mit einem Kind, das seinen Namen nicht schreiben konnte. Ich war vierzehn und ritt mit meinem alten Lehrmeister, Herrn Liebermann, über die Felder, als wir auf einen Jungen trafen, der ein entlaufenes Lamm suchte. Ich fragte ihn, wie er hieß, und er antwortete stolz: „Fritz vom Holzweg.” Als ich ihm einen Bleistift gab und bat, seinen Namen zu schreiben, starrte er mich nur an. Er konnte nicht einmal die Buchstaben benennen. In meinem Elternhaus war Bildung selbstverständlich. Ich hatte Latein gelernt, Französisch gelesen, Aufsätze über Cicero geschrieben. Doch für die Kinder im Dorf gab es nichts – keine Bücher, keine Schule, keinen Unterricht. „Wozu auch?”, sagte Baron von Rabenhorst später, als ich ihn darauf ansprach. „Ein Bauer muss pflügen, nicht philosophieren.” Ich aber glaubte das Gegenteil: Ein Volk, das denkt, ist ein starkes Volk.
Im Frühjahr 1812, mitten zwischen den Reformen, die Preußen nach dem Krieg umwälzten, ließ ich die alte Scheune oberhalb des Dorfs umbauen. Wo einst Heu gelagert wurde, standen bald Tische und Bänke. Ich bestellte einen jungen Lehrer aus Königsberg – Herr Baumgarten, kaum älter als ich, aber voller Ideen. Er unterrichtete Lesen, Schreiben, Rechnen – aber auch Geschichte und Musik. Die Bauernkinder kamen in Scharen. Erst zögerlich, dann neugierig. Viele brachten Kartoffeln oder Eier als Bezahlung. Ich erinnere mich an die kleine Anna, die mit bloßen Füßen kam und sich nicht traute zu sprechen. Nach einem halben Jahr sang sie ein Volkslied vor der ganzen Klasse. Ich schrieb an das Kultusministerium in Berlin, bat um Unterstützung für die Landschulen. Und zur Überraschung meines Verwalters kam tatsächlich eine Antwort – samt einer Kiste mit Schulbüchern und einer Empfehlung, weitere Schulen nach dem Humboldtschen Modell zu gründen. Die Idee des großen Wilhelm von Humboldt war damals neu und mutig: Bildung nicht nur für den Beruf – sondern für das Leben.
Ich nahm mir das zu Herzen. Kein Kind auf Falkenstein sollte zurückbleiben. Natürlich gab es Widerstand. Die Großbauern murrten: „Wer in der Schule sitzt, hilft nicht auf dem Feld!” Und ein alter Knecht sagte grimmig: „Wenn die Jungen zu viel wissen, wollen sie nicht mehr gehorchen.” Ich aber sah: Je mehr die Kinder lernten, desto mehr verstanden sie die Welt – und sich selbst. Heute, wenn ich durch das Dorf gehe, lese ich Schilder an den Werkstätten: „Schneiderei Schulze” – „Buchbinder Wilhelm & Sohn” – „Backstube Anna Falk”. Es sind die Namen jener Kinder, die einst in der Scheune auf dem Hügel saßen. Sie führen nun ihre eigenen Betriebe. Sie schreiben, sie rechnen, sie planen. Manche zogen in die Stadt, wurden Lehrer, Beamte oder Ärzte. Sie alle begannen hier – mit einem Stück Kreide und einem Traum. Und ich, Albrecht von Falkenstein, habe gelernt: Nicht Macht macht ein Land groß – sondern Bildung.
4. Zwischen Pflug und Gewehr
Ein Bauernsohn erzählt

Ich war achtzehn, als der Einberufungsbrief kam. Der Knecht brachte ihn morgens aufs Feld, wo ich gerade mit meinem Vater den Pflug richtete. Das Papier war grau, das Siegel preußisch-schwarz. Ich wischte mir die Hände an der Hose ab, öffnete es – und da stand es: Ich, Friedrich Meißner, soll zum Militär. Mein Vater nickte nur. „Du gehst. Du lernst. Und du kommst zurück.” Ich nahm mein Bündel, verabschiedete mich von Mutter und meiner Schwester Leni – und ging los, mit Herzklopfen und einem Kopf voller Fragen. Ich kam in eine Welt, die ganz anders war als unser Dorf. Da war ein Schreiber aus Breslau, der Gedichte schrieb. Ein Bergmann aus Schlesien, der nie das Tageslicht sah. Und sogar ein Jude aus Königsberg, der besser Latein sprach als unser Pastor. Wir trugen dieselbe Uniform, standen in derselben Reihe, aßen denselben Brei. Der Feldwebel, ein ehemaliger Schneider, bellte uns Kommandos zu. „Stillgestanden!” – „Links um!” – „Lauft wie ein Gedanke, nicht wie eine Kuh!” Und doch – unter dem Drill wuchs etwas Seltsames: eine Kameradschaft. Ich hatte geglaubt, als Bauer sei ich nichts wert. Doch hier zählte Können, nicht Herkunft. Ich konnte gut zielen, also wurde ich Schütze. Ich konnte klar denken, also durfte ich berichten. Und als der Hauptmann krank wurde, übertrug man mir die Leitung eines kleinen Zuges – mir, einem Bauernsohn aus Falkenstein. Wir lernten nicht nur Krieg, sondern auch Staat und Geschichte. Wir diskutierten – über Freiheit, Pflicht und das neue Preußen. Ich begann zu begreifen: Nicht nur wir Bauern veränderten uns. Das ganze Land tat es. Als mein Dienst endete, war der Winter gerade vorbei. Ich kehrte zurück – mit geradem Rücken und einem kleinen Bündel. Falkenstein war noch da: der Glockenturm, die Felder, der große Kastanienbaum vor dem Schloss. Aber es war auch anders. Über dem Dorf lag ein neuer Ton – ernster, stolzer. Ich wurde ins Herrenhaus gebeten. Graf Albrecht von Falkenstein saß am Fenster, ein Stapel Bücher vor sich, die Hände verschränkt. „Friedrich Meißner”, sagte er lächelnd, „du bist zurück. Erzähl mir – was hast du gelernt, dort draußen in der neuen Armee?” Ich setzte mich – zögernd. Dann sprach ich: „Herr Graf, ich habe gelernt, dass ein Mann mehr ist als sein Stand. Dass Disziplin kein Zwang ist, sondern ein Weg. Und dass Preußen stärker wird, je mehr es auf seine Menschen vertraut.” Der Graf nickte. „Und hast du Angst gehabt?” Ich schwieg kurz. „Ja. Vor dem ersten Befehl. Vor dem Versagen. Aber nie vor dem Feind. Denn ich wusste: Ich kämpfe nicht für Macht. Ich kämpfe für ein Land, das mich sieht – als Mensch.” Der Graf sah mich lange an. Dann sagte er leise: „Dann haben wir nicht nur ein Heer gewonnen – sondern ein neues Volk.”
Heute leite ich die Dorfschule für die Jungen, die bald selber eingezogen werden. Ich zeige ihnen, wie man marschiert, aber auch, wie man denkt. Und manchmal stehe ich beim alten Brunnen, sehe den Grafen durchs Dorf gehen – und weiß: Wir haben dieses neue Preußen zusammen gebaut.
Mit Pflug - mit Gewehr - mit Herz.
5. Ordnung und Recht – Ein neues Preußen entsteht
Erzählt von Albrecht, Graf von Falkenstein
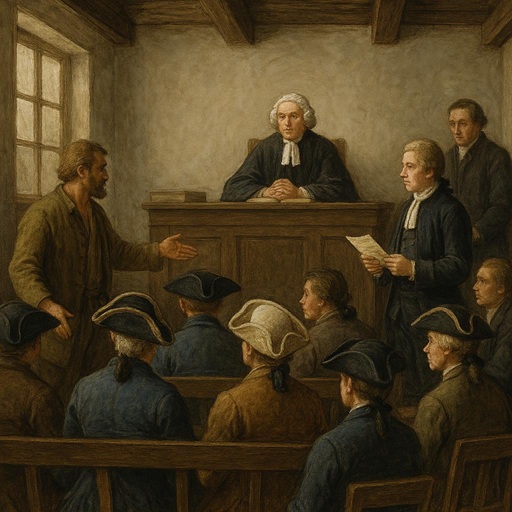
Wenn ich heute durch mein Amtszimmer gehe, liegt dort kein einziges Pergament mit einem königlichen Wappen mehr auf dem Schreibtisch. Stattdessen: Akten, Tabellen, Listen – sauber geführt von meinem Verwalter Herr Schnorr, einem Mann mit Brille, Tintenflecken und scharfem Verstand. Er war der Erste auf Falkenstein, der nicht adelig war und doch einen Platz in der Verwaltung erhielt. Und er war nicht der Letzte. Nach den napoleonischen Kriegen war in Preußen vieles zerbrochen – aber gerade deshalb wagte man Neues. Es war Karl vom und zum Stein, der Minister, der sagte: „Nicht Geburt soll entscheiden, sondern Tüchtigkeit.”
Ein Satz, der im Ohr des alten Adels wie ein Donnerschlag klang – für mich aber war er wie ein Lichtstrahl. Früher war Verwaltung eine Sache der wenigen – der Reichen, der Titelträger. Ein Graf entschied im eigenen Kreis, wer recht hatte und wer nicht. Richter waren oft Verwandte, Verwalter, alte Kameraden. Gerecht war das selten. Jetzt aber wurde das Reich neu gegliedert: in Provinzen, Regierungsbezirke, Kreise und Gemeinden. Jeder Kreis bekam einen Landrat, jede Gemeinde einen Bürgermeister – gewählt oder ernannt nach Befähigung, nicht nach Familiennamen. Der größte Schritt war jedoch die Trennung von Justiz und Verwaltung. Ich kannte noch die Zeit, da ein Gutsbesitzer wie mein Onkel Friedrich in einer Angelegenheit des Dorfbaches sowohl Kläger, Richter als auch Vollstrecker war. Er entschied, dass der Bach umgeleitet werden sollte, weil ihn das Quaken der Frösche störte – und ließ die Bauern dazu zwingen, die Arbeit zu machen. Jetzt war das unmöglich. Wer einen Streit hatte, ging zum Kreisgericht. Und dort saß ein Richter, unabhängig, geprüft, vereidigt. Ich musste sogar einmal gegen einen Pächter vor Gericht erscheinen – und verlor. Es war ein seltsames Gefühl. Aber ich wusste: Es war richtig.
Viele meiner Nachbarn schimpften über die neuen Beamten: „Sie tragen keine Schwerter, sondern Stempel!” „Sie wissen alles aus Büchern, aber nichts vom Leben!” Ich aber schätzte sie. Herr Schnorr zum Beispiel war der Sohn eines Schusters aus Thorn. Er konnte doppelt so schnell rechnen wie ich und sprach drei Sprachen. Dank der Reformen durfte er Verwaltungsbeamter werden. Er führte das Steuerbuch genauer als je einer vor ihm – und wusste, dass Gerechtigkeit manchmal auch in Zahlen liegt. Einmal, bei einem Treffen im Herrenhaus von Königsberg, erhob sich Baron von Rabenhorst mit rotem Kopf und rief: „Wollt ihr wirklich, dass ein Beamter aus dem Volk über einen Grafen urteilt?” Ich antwortete ruhig: „Wenn der Beamte recht hat, ja. Und wenn der Graf Unrecht hat, erst recht.” Es wurde still. Dann lachten einige. Später hörte ich, dass zwei junge Offiziere aus gutem Haus mir heimlich dankten. Sie glaubten an das neue Preußen – wie ich.
Heute, auf Falkenstein, herrscht keine Willkür mehr. Die Wege der Entscheidungen sind länger – aber sie sind klar. Die Bauern wissen, wohin sie sich wenden können. Die Verwalter wissen, dass ihr Amt nicht Geschenk, sondern Verantwortung ist. Und ich weiß, dass mein Titel allein nichts bedeutet, wenn ich mich nicht bewähre. Preußen hat sich verändert. Es ist nicht mehr nur ein Reich des Schwertes, sondern eines des Rechts. Und ich, Albrecht von Falkenstein, werde diesen Weg weitergehen – nicht als Herrscher über Menschen, sondern als Diener eines besseren Staates.
6. Hämmer und Hoffnung – Wie Preußen sich neu erschuf
Erzählt von Albrecht, Graf von Falkenstein

Es begann mit dem Klopfen von Hämmern. Nicht dem Hämmern der Zimmerleute auf den Dächern, sondern einem neuen Klang – aus einer Werkstatt unten im Dorf, wo einst ein leerer Schuppen stand. Dort arbeitete nun Karl Meißner, der Sohn eines einstigen Tagelöhners. Und er hatte gewagt, was vor wenigen Jahren noch undenkbar gewesen wäre: Er hatte eine Schmiede gegründet. Ohne Zunft, ohne Erlaubnis eines Stadtrates, nur mit Wissen, Mut und zwei starken Armen. Früher waren alle Handwerke streng geregelt. Wer nicht Mitglied einer Zunft war, durfte kein Meister sein, kein eigenes Geschäft eröffnen, nicht einmal selbständig sägen oder nähen. Die Zünfte entschieden, wer aufgenommen wurde – und meist entschieden sie gegen die Armen und die Aufsteiger. Doch mit den Wirtschaftsreformen nach den Napoleonischen Kriegen änderte sich das: Gewerbefreiheit wurde eingeführt. Plötzlich durfte jeder, der etwas konnte, ein Geschäft eröffnen – ein Weber, ein Müller, ein Seifensieder. Auch auf Falkenstein veränderte sich alles. Innerhalb weniger Jahre entstanden neue Werkstätten im Dorf:
- - ein Wagner, der Räder herstellte,
- - eine kleine Seilerei, geführt von zwei Schwestern,
- - eine Bäckerei, in der auch sonntags gearbeitet wurde.
Ich erlaubte den Aufbau eines kleinen Marktplatzes, ließ einen gepflasterten Weg anlegen, der das Gut mit der Fernstraße verband. Vorbei die Zeit der Matschpfade und Karren, die im Morast stecken blieben. Ich weiß noch, wie stolz ich war, als der erste Händler aus der Stadt kam, seinen Wagen entlud und sagte: „Falkenstein ist kein Flecken mehr. Es wird ein Ort.” Die Reformen betrafen nicht nur das Gewerbe, sondern auch die Infrastruktur. In den Behörden sprachen sie von „Verkehrsadern” – ein kaltes Wort für etwas sehr Lebendiges: neue Straßen, Kanäle, Brücken. Falkenstein lag abseits, aber durch die neue Kreisstraße wurde es angeschlossen an den Flusshandel der Weichsel. Ein Jahr später kamen die ersten Ziegel per Boot, schneller und billiger als je zuvor. Ich selbst reiste nach Elbing, sah dort einen Hafen mit dampfbetriebenen Kränen. Ich spürte: Die Welt wurde schneller. Und wer nicht mitging, blieb zurück. Eines Tages kam ein Mann zu mir, Herr Löwenthal aus Berlin. Er trug einen langen Mantel, roch nach Kohle und Papier. „Graf von Falkenstein,” sagte er, „hier gibt es Erz im Boden. Wenn Sie erlauben, gründen wir eine Werkstatt zur Herstellung von Geräten für die Landwirtschaft.” Ich war zuerst skeptisch. Maschinen auf meinem Land? Aber ich erinnerte mich an das Klopfen in Karls Schmiede – und an das Leuchten in den Augen der jungen Männer, die dort arbeiteten. Ein Jahr später standen erste Werkhallen auf einem Hügel hinter dem Gut. Klein, rauchend, laut. Und voller Leben. Nicht alles war einfach. Manche Bauern fürchteten die Maschinen. Manche Adlige schimpften, Preußen werde zur Werkstatt statt zum Königreich. Aber ich sah es anders: Arbeit, die auf Freiheit basiert, ist mehr wert als Gold.
Und ich sah, wie sich unsere Welt wandelte – vom Ackerland zum Ort der Möglichkeiten. Es war nicht mehr die Zeit der Titel, sondern die Zeit der Tat. Und so lernte ich, Albrecht von Falkenstein: Der wahre Reichtum eines Landes liegt nicht in Schlössern, sondern in Werkstätten. Nicht in Ahnenwappen, sondern in den Händen derer, die Neues schaffen.
7. Aus Erde wird Glanz – Die Idee der Porzellanmanufaktur
Erzählt von Albrecht, Graf von Falkenstein

Ich liebe das Land. Den Duft frisch gepflügter Erde, das Knacken des Getreides im Wind, das langsame Wachsen der Dinge. Aber ich bin nicht blind. Ich sehe, wie andere Gegenden wachsen, wie Schornsteine in den Himmel steigen und neue Arbeit schaffen – mit Dampf, Hammer und Verstand. Preußen verändert sich. Und ich frage mich: Soll Falkenstein nur Korn liefern – oder auch Ideen? Es begann mit einem Bauernjungen, der beim Graben hinter dem neuen Brunnen auf eine merkwürdige, rötliche Erde stieß. Fettig in der Hand, glatt, beinahe weich. Ich ließ Proben untersuchen. Der Geologe aus Elbing lächelte: „Das ist Ton, Herr Graf. Feiner Ton. Gut für Ziegel – und vielleicht mehr.” Ich fuhr selbst hinaus, sah die Stelle. Ein kleiner Abhang, feucht, unscheinbar. Und doch spürte ich: Hier liegt etwas, das nicht nur Häuser baut – sondern Gedanken formt. Mit einfachen Mitteln begann ich. Ich stellte zwei Töpfer ein – ehemalige Handwerker aus Thorn, die durch die Gewerbefreiheit ein neues Leben suchten. Wir bauten einen Schuppen, brannten ein erstes Ofenloch, formten Krüge, Schalen, Teller. Der Anfang war schwer. Die Glasur riss. Das richtige Rezept für unsere Sorte Ton wollte erst gefunden werden. Aber die Hände wurden sicherer. Die Gefäße glatter. Und bald standen sie auf dem Markt von Marienwerder – mit dem Stempel „Falkenstein 1” am Boden. Ich verkaufte sie nicht teuer. Ich wollte, dass man sie benutzte, nicht bewunderte. Eines Abends saß ich mit Herrn Schnorr, meinem Verwalter, beim Tee. Ich drehte eine der neuen Tassen in der Hand, betrachtete die feinen Linien, das Licht, das sich in der Glasur brach. „Warum nur Ton?” fragte ich leise. „Warum nicht Porzellan?” Er lächelte müde. „Porzellan ist die Kunst der Könige. Sie ist teuer, heikel – aber edel. Und riskant.” Ich antwortete: „Dann ist sie genau richtig für Falkenstein.” Ich schrieb nach Berlin, bat um Bücher, Formeln, Kontakte. Ich reiste nach Meißen, inkognito, sah die großen Brennöfen, das Spiel von Hitze, Geduld und Talent. Zurück auf Falkenstein gründete ich eine kleine Werkstatt, getrennt von der Töpferei. Ich stellte junge Menschen ein – Bauernkinder mit ruhigen Händen, scharfen Augen, wachen Gedanken. Ich nannte sie nicht Arbeiter, sondern Kunsthandwerker. Wir scheiterten oft. Die Masse zersprang. Die Farbe verblasste. Aber langsam, sehr langsam – wuchs aus dem Ton ein Traum. Heute steht auf einem Hügel über dem Dorf ein langes Gebäude aus Backstein, weiß getüncht, mit Fenstern, durch die man den Glanz des Ofens sehen kann. Dort entstehen Teller mit goldenen Rändern. Tassen, so fein, dass Licht hindurchscheint. Die Menschen im Dorf nennen es die „weiße Werkstatt”. Und ich nenne es: Hoffnung.
Denn ich, Albrecht von Falkenstein, glaube nicht nur an die Kraft der Erde – sondern auch an das Feuer des Geistes. Falkenstein wird wachsen. Nicht mit Gewalt. Nicht mit Gier. Sondern mit Form, mit Würde – und mit einem Krug aus Ton, der den Glanz der Zukunft in sich trägt.
8. Dampf gegen Degen – Ein Streit auf Schloss Rabenhorst
Erzählt von Albrecht, Graf von Falkenstein

Der Saal auf Schloss Rabenhorst war kalt, trotz Kaminfeuer. Die Luft war schwer vom Rauch teurer Zigarren und dem Duft alten Leders. Ich stand an einem der hohen Fenster, das hinausblickte auf kahle Winterbäume. Neben mir saßen sie: die alten Namen Preußens. Freiherr von Mühlenberg, der schon mit meinem Großvater zur Jagd ritt. Oberst a. D. von Treuenfels, der bei Jena kämpfte. Und natürlich: Baron Julius von Rabenhorst, Gastgeber, Großsprecher und der größte Gegner jeder Veränderung. Ich war eingeladen worden, um von der neuen Werkstatt auf Falkenstein zu berichten. Ich hätte wissen müssen, dass es kein Interesse war, das mich hierher führte – sondern Widerstand. „Also, junger Falkenstein,” begann Rabenhorst, während er mit der Spitze seines Spazierstocks auf den Boden tippte, „man hört, Sie lassen Fabriken aufbauen. Maschinen. Rauch. Lärm. Und das alles mitten auf gutem Ackerland?” Ich blieb ruhig. „Ja, Baron. Und die ersten Geräte, die wir bauen, helfen den Bauern beim Säen. Sie sparen Zeit – und Rückenschmerzen.” Treuenfels schnaubte. „Säen? Früher säten wir mit der Hand, wie es sich gehört. Diese ganze Mechanik … entmenschlicht die Arbeit.” Ich sah ihn an. „Ich glaube, sie befreit sie.” „Es ist eine Schande”, fuhr Freiherr von Mühlenberg dazwischen. „Ein Graf sollte über Felder herrschen, nicht über Schornsteine! Was bleibt denn vom Stand, wenn selbst ein Schuster eine Manufaktur gründen darf?” Ich trat vor. „Was bleibt vom Stand, wenn er nichts mehr taugt?” Die Worte waren heraus, bevor ich sie stoppen konnte. Es wurde still. Nur das Knistern im Kamin war zu hören. Baron Rabenhorst stand auf, langsam, mit einem knarrenden Stuhl. „Ihr jungen Adligen habt vergessen, was Preußen groß gemacht hat: Ordnung. Ehre. Disziplin. Nicht Handel. Nicht Profit. Und gewiss keine Dampfmaschinen.” Ich antwortete: „Preußen wurde nicht durch Stillstand groß, sondern durch Mut. Die Bauern, die Soldaten, die Handwerker – sie haben das Land getragen. Nicht die Tänze in unseren Sälen.” Er trat näher, fast Nase an Nase. „Sie glauben also, ein Graf sollte sich die Hände schmutzig machen?” Ich nickte. „Lieber schwarze Hände vom Ruß, als weiße vom Stillstand.” Ich verließ den Saal wenig später. Keiner hielt mich auf. Doch als ich den Mantel anzog, trat ein junger Leutnant an mich heran. Er war ein Neffe von Treuenfels. Er reichte mir die Hand. „Ich glaube, Sie haben recht, Herr Graf,” flüsterte er. „Mein Vater sagt, ich soll Offizier werden. Aber ich will bauen. Maschinen. Eisenbahnen. Die Zukunft.” Ich lächelte. „Dann baue sie. Preußen braucht nicht nur Tapfere – sondern Tüftler.”
Und so wusste ich an jenem Abend: Der Adel, der nicht mit der Zeit geht, wird von ihr überrollt. Und ich, Albrecht von Falkenstein, wollte lieber ein Diener der Zukunft sein – als ein Denkmal der Vergangenheit.