Die Germania
1. Ein Land in Stücken

Friedrich wundert sich bis heute, dass man einfach durch einen Wald spazieren kann – und plötzlich steht man in einem anderen Land, ohne es zu merken. Nur die Uniformen der Zöllner ändern sich, oder die Farbe der Grenzsteine. Einmal, als er mit seinem Vater von Hanau nach Fulda reiste, wurden sie dreimal kontrolliert – einmal wegen Salz, einmal wegen der Bücher, die sein Vater bei sich trug, und schließlich wegen eines Liedes, das Friedrich gepfiffen hatte. Ein verbotenes Lied. „Jedes Fürstlein spielt seinen eigenen König”, murmelte sein Vater damals. „Und wir alle zahlen den Preis.” Damals – Anfang der 1830er Jahre – versteht Friedrich noch nicht, was das bedeutet. Doch je älter er wird, desto klarer sieht er: Deutschland ist kein Land. Es ist ein Flickenteppich aus Kleinstaaten, Herzogtümern, Bistümern, Königreichen. Jeder regiert nach eigener Laune. Eine Zeitung, die in Weimar erlaubt ist, ist in Bayern verboten. Ein Lehrer wird in einem Staat verhaftet – und im Nachbarstaat gefeiert. Er erinnert sich an die Landkarte in der Stube seines Onkels. Ein wirres Netz aus Farben und Linien – eher ein misslungener Malkasten als ein echtes Nationenbild: Preußen, Österreich, Sachsen, Baden, Hessen, Bayern – dazwischen winzige Enklaven, freie Städte, geistliche Territorien, Ordensbesitz. Kein Wunder, dass niemand durchblickt. Der Deutsche Bund, gegründet nach dem Wiener Kongress, soll Einheit bringen – doch in Wahrheit ist er ein Pakt der Fürsten gegen das Volk. Alles, was nach Freiheit riecht, wird unterdrückt. Die Karlsbader Beschlüsse verbieten die Pressefreiheit. Die Burschenschaften werden zerschlagen. Denunziation gehört zum Alltag. Und doch: unter der Oberfläche brodelt es. In Leipzig liest Friedrich heimlich Heine. In Heidelberg lernt er, dass ein Vaterland nicht nur aus Grenzen besteht, sondern aus Sprache, Dichtung, Hoffnung. Und wenn nachts in dunklen Kneipen das „Lied der Deutschen” angestimmt wird – noch keine Nationalhymne, aber schon voller Sehnsucht –, sieht er in den Gesichtern seiner Kommilitonen denselben Traum: ein geeintes Land. Nicht durch Zwang, sondern aus freiem Willen. Nicht durch Macht, sondern durch Recht. „Deutschland liegt nicht zwischen Rhein und Oder”, sagt ein alter Professor einmal, „es liegt im Herzen derer, die es sich vorstellen können.” Aber Vorstellungen reichen nicht. Jahr für Jahr sterben Hoffnungen in den Akten der Fürstenhöfe, in den Zellen der Zensoren, in der Angst der Eltern, ihre Söhne könnten sich infizieren – mit Gedanken, mit Mut. Deutschland spricht eine Sprache, doch jeder Fürst flüstert sie anders. Und wer laut spricht, muss schweigen. Jetzt ist das Jahr 1848, und die Stadt bebt vor Unruhe. Überall wird diskutiert, gestritten, geträumt. Studenten, Handwerker, Lehrer – sie alle strömen in die Paulskirche, wo zum ersten Mal in der Geschichte des zersplitterten Deutschlands Abgeordnete aus allen Landen zusammenkommen. Friedrich ist kein Abgeordneter. Er ist Lehrer, gerade zwanzig Jahre alt, mit flammendem Herzen und Tinte an den Fingern. Aber er ist da – mittendrin in dieser Aufbruchsstimmung, in diesem Knistern, das durch die Luft geht wie Strom. Mit vierundzwanzig spricht er das erste Mal öffentlich von einem einigen Deutschland. Er steht auf einem Feld bei Gießen, umgeben von Gleichgesinnten, vor einer improvisierten Tribüne aus Apfelkisten. Die Worte zittern – aber sie sind da: „Ein Land, ein Recht, ein Volk.” „Ein freies Deutschland für freie Menschen!”, ruft ein Redner später auf dem Römerberg. Die Menge jubelt. Fahnen werden geschwenkt. Friedrichs Herz klopft. Und doch: die alten Mächte – die Fürsten, Könige, Kaiser – lauern im Hintergrund. Sie schmieden ihre Pläne, sie schicken Soldaten. Die Revolution scheitert. Die Hoffnung zersplittert – wie Fensterscheiben nach dem Barrikadenkampf in Wien und Berlin. Friedrich verliert seinen Posten. Luise, seine Geliebte, geht nach Zürich. Seine Schriften werden verboten. Und doch: Er schreibt weiter. Heimlich. Nachts. Bei Kerzenlicht. Von einem Deutschland, das mehr ist als ein Flickenteppich. Von einem Volk, das zusammengehört. Er schickt seine Texte an Freunde, versteckt sie in Bucheinbänden, schmuggelt sie über die Grenzen. Jahre vergehen. Jahrzehnte. Neue Kriege kommen. Neue Könige. Friedrich wird älter. Aber seine Sehnsucht bleibt jung. Sie ist gefährlich. Sie ist verboten. Aber sie ist notwendig.
2. Endlich Eins

Der Frost liegt wie ein Schleier über den französischen Ebenen. Die Felder bei Versailles schweigen, weiß überzogen, als hielte der Winter selbst den Atem an. Friedrich, inzwischen Unteroffizier, steht in Reih und Glied auf dem großen Vorplatz des Schlosses. Seine Stiefel sind im gefrorenen Boden verankert, die rechte Hand ruht am Gewehr – das Herz pocht so heftig wie nie zuvor. An seiner Brust funkelt das Eiserne Kreuz. Ein schmales schwarzes Band mit silberner Fassung. Eine Auszeichnung für Tapferkeit – so heißt es. Doch als Friedrich seine verwundeten Kameraden im Feuerhagel von Gravelotte in einen französischen Graben zieht, nachdem seine Einheit diesen Graben genommen hat, denkt er nicht an Heldentum. Er handelt einfach. Aus Notwendigkeit. Aus Pflicht. Und doch trägt er nun das Kreuz. Und heute, am 18. Januar 1871, bekommt alles eine neue Bedeutung. Nicht nur Mut – Einheit. Versailles. Der Spiegelsaal. Der Ort, an dem französische Könige einst in Gold und Glanz wandelten, wird heute zur Geburtsstätte eines neuen Reiches. Der neue Kaiser soll proklamiert werden: Wilhelm I., König von Preußen – nun „Deutscher Kaiser”. Friedrichs Blick wandert zu den hohen Fenstern der Galerie, hinter denen sich Fürsten, Generäle und Gesandte versammeln. Alles wirkt vorbereitet, fast feierlich. Im Hintergrund steht Bismarck, unbewegt wie eine Statue, der Architekt dieses Tages. Die Fahnen Preußens, Bayerns, Sachsens, Württembergs hängen nebeneinander – zum ersten Mal gleichwertig. Keine über der anderen. „Wir sind eins”, denkt Friedrich. „Wir sind endlich eins.” Wie oft träumte er in seiner Jugend davon? Diskutierte heimlich in Hinterzimmern, beschwor es in Gedichten, verteilte Flugblätter – immer mit der Angst im Nacken, dafür verhaftet zu werden. Und jetzt? Jetzt steht er hier. Vereint durch Krieg, durch Blut, durch einen eisernen Willen. Die Trommeln schlagen. Die Türen öffnen sich. Die Stimmen drinnen werden leiser. Friedrich kann die Worte nur erahnen – „Im Namen des deutschen Volkes …” Dann ertönt der Ruf: „Es lebe der Kaiser! Es lebe das Deutsche Reich!” Ein donnerndes Hurra bricht los. Mützen fliegen in die Luft. Friedrich reißt die Hand an die Mütze, salutiert – nicht nur dem Kaiser. Auch all jenen, die diesen Moment nicht mehr erleben: den Brüdern auf dem Schlachtfeld, den Revolutionären von 1848, den heimlich lesenden Studenten, den Verbannten und Verschollenen. Seine Augen brennen. Nicht vor Kälte. Sondern vor etwas, das größer ist als Stolz. Daran werden sich die Deutschen erinnern. Für immer. Aber eines fehlt noch: ein Ort. Der Palast von Versailles kann das nicht sein. Zu französisch. Zu fremd. Und das Land auf ewig zu besetzen – das ist undenkbar. Friedrich spürt es: Der große Moment braucht ein eigenes Denkmal. Ein deutsches. Einen Ort, an dem nicht Eroberung gefeiert wird, sondern die Einheit. Nicht in Marmor fremder Könige – sondern in Stein aus deutschem Boden.
3. Ein Denkmal für den Traum
Das Rheintal bei der Loreley

Es ist ein klarer Frühlingstag am Rhein, als Friedrich mit seinem alten Kameraden Heinrich oberhalb der Loreley steht. Unter ihnen glänzt das Wasser in der Sonne, dahinter breitet sich die endlose Weite des Vaterlands aus – endlich vereint, doch noch so jung. „Jedes Volk hat seine Symbole”, sagt Heinrich, als er sich auf einen Findling setzt. „Die Franzosen haben Marianne. Die Briten ihren Löwen. Die Russen den Zarenadler. Und wir?” Friedrich schweigt. In Versailles jubelte er. Aber mit jedem Jahr spürt er deutlicher: Einheit allein genügt nicht. Man muss sie tragen, bewahren, mit Bedeutung füllen. Die Soldaten kämpfen, doch das Denken, das Erinnern – das ist die Aufgabe der nächsten Generation. „Was meinst du, Friedrich? Ein Reiterstandbild des Kaisers?” Heinrich grinst. „Noch eins?” Friedrich setzt sich unter eine knorrige Linde. Unten rauschen die Wellen, als flüsterten sie Geschichten, älter als jedes Kaiserreich. In Gedanken geht er alte Verse durch, die er kennt, die ihn geprägt haben: Brentano, Heine, Eichendorff. Der Rhein ist in diesen Liedern kein Fluss, sondern eine Seele. Eine deutsche Seele. Nicht scharf umrissen, nicht durch Grenzen definiert, sondern weich, melodisch, voller Melancholie und Majestät. „Ich weiß nicht, was soll es bedeuten …”, murmelt er fast mechanisch. Das Loreley-Lied ist längst Allgemeingut geworden, fast wie ein stilles Volksgebet. Es erzählt nicht nur von einer Frau, sondern von dem, was verloren geht – und nie ganz zu fassen ist. Die Gelehrten nennen es Rheinromantik. Für Friedrich ist es eher ein stilles Heimweh – nach einem Deutschland, das nicht aus Paraden besteht, sondern aus Dörfern, Liedern, Träumen. Ein Land aus Burgen und Ruinen, aus alten Sagen und flüchtigen Sonnenuntergängen. Hier, am Strom, existieren keine sichtbaren Grenzen. Die Hügel schieben sich ineinander, Städte gehen ineinander über, die Sprache klingt gleich – ob Mainz, Bingen oder Koblenz. Der Rhein verbindet – er spaltet nicht. Vielleicht, denkt Friedrich, haben die Dichter mehr zur Einheit beigetragen als so mancher Minister. Er schließt die Augen. Vor sich sieht er die Ruine der Burg Ehrenfels im Dämmerlicht. Ein Schwarm Vögel fliegt über das Wasser. In der Ferne klingt das dumpfe Horn eines Schiffes. Der Fluss lebt. Er ist nicht nur Natur – er ist Kultur. Als Kind warf Friedrich Steine ins Wasser und fragte sich, ob sie bis nach Holland treiben. Jetzt, Jahrzehnte später, weiß er: Nicht der Stein treibt – sondern die Sehnsucht. Die Sehnsucht nach einem Land, das zusammengehört, weil es fühlt, nicht weil es befehligt wird. Friedrich legt die Hand auf den Boden. „Der Rhein ist unsere Ader”, flüstert er. „Er führt das Herz in die Zukunft – aber es schlägt rückwärts, in die Tiefe unserer Geschichten.” „Nein”, antwortet er schließlich, leise aber bestimmt. „Ein Denkmal nicht für die Macht – sondern für den Geist.” Er tritt an die Kante des Hangs. Der Wind trägt den Duft des Frühlings heran. In seinem Kopf flackern Bilder auf: die Barrikaden von 1848, die Tränen in den Augen seines alten Lehrers, die ersten Worte der Verfassung, die Uniformen der Verbündeten im Spiegelsaal von Versailles. „Germania”, sagt er dann. Heinrich runzelt die Stirn. „Die Figur der Germania – groß, standhaft, erhobenen Hauptes. Nicht kriegerisch wie eine Göttin, nicht untertänig wie eine Muse. Sondern wachsam, stolz, schützend. Eine, die nicht herrscht, sondern erinnert.” Heinrich schweigt. „Sie soll nicht den Sieg zeigen, sondern das Versprechen. Nicht: Wir haben gewonnen. Sondern: Wir sind geworden.” Friedrichs Blick schweift über das Land. „Sie soll hier stehen. Über dem Rhein. Wo Römer, Germanen, Franken und Preußen ihren Fuß gesetzt haben. Wo man in alle Himmelsrichtungen schauen kann. Ein Denkmal aus Stein und Erz – aber getragen von der Idee, dass dieses Volk mehr ist als Blut und Boden. Dass wir zusammengehören, weil wir es wollen – nicht weil wir es müssen.” Heinrich nickt langsam. „Germania also.” Friedrich sieht ihn an. „Nicht als Herrscherin. Sondern als Zeugin. Als Mahnung. Und als Hoffnung.” Er ist nur ein Veteran. Aber oft haben mehrere Menschen denselben Gedanken zur gleichen Zeit – das zeigen nicht nur viele parallele Erfindungen. In der Ferne ziehen Schiffe den Fluss hinab. Die Zukunft kommt – ob man will oder nicht. Aber vielleicht, nur vielleicht, kann man ihr einen Ort geben, an dem sie sich erinnert, woher sie kommt.
4. Ein weiterer Dienst
Frühling 1871

Der Frühling des Jahres 1871 ist voller Jubel – und voller Unruhe. Die Siege sind errungen, das Reich ist gegründet, der Kaiser proklamiert. Aber nun erhebt sich eine andere Frage: Wie erinnert man an einen historischen Moment, ohne ihn sofort zu verlieren? Friedrich spürt, dass etwas in der Luft liegt. Es ist nicht mehr nur der Wind vom Rhein – es ist ein Ruf, ein Bedürfnis, das durch viele Köpfe und Herzen geht: Lasst uns diesen Augenblick bewahren! Lasst uns ihn sehen können, wenn wir alt sind. Lasst ihn aus Stein sprechen! Und Friedrich ist nicht allein. In ganz Deutschland schreiben Bürger Leserbriefe, Lehrer halten patriotische Ansprachen, Veteranen diskutieren in Wirtshäusern. Der Gedanke wächst: ein Denkmal. Nicht nur für den Kaiser, nicht für den Krieg – sondern für die Einheit selbst. Am 13. April ist es schließlich ein Schriftsteller aus Mainz, Ferdinand Hey’l, der die zerstreuten Gedanken bündelt. Im „Rheinischen Kurier” schlägt er mit klarer Feder einen Ort vor, der alles verbindet: Geschichte, Landschaft, Symbolkraft. „Der Niederwald über Rüdesheim, mit seinem Blick auf das Rheintal, soll der Ort sein, an dem das Denkmal unserer Reichsgründung stehen wird.” Friedrich liest diese Zeilen, als er in Wiesbaden im Amtsblatt blättert. Er springt auf, als habe ihn ein Blitz getroffen. Niederwald! Dort, wo er selbst in den Weinbergen gestanden, die Loreley betrachtet, von Germania gesprochen hat. Der Ort ist nicht nur schön – er ist bedeutungsvoll. Eine natürliche Bühne für den Traum eines Volkes. Und er ist nicht der Einzige, den Hey’ls Worte bewegen. Botho Graf zu Eulenburg, Regierungspräsident in Wiesbaden, liest den Artikel und soll – so erzählt man sich – nur nicken und sagen: „Ja. Genau dort.” Mit seiner Stellung, seinem Einfluss und seinem diplomatischen Geschick macht er sich sogleich ans Werk. Er spricht mit den zuständigen Stellen, mit dem Innenministerium, mit Vertretern des Heeres und mit Künstlern. Friedrich ist beeindruckt. „Ein Denkmal zu bauen”, sagt er zu Heinrich bei einer Tasse Wein, „ist nicht allein eine Sache des Handwerks. Es ist Politik, Poesie und Menschenführung.” „Und was soll es zeigen?” fragt Heinrich. Friedrich antwortet ohne Zögern: „Germania.” „Schon wieder du und deine Germania”, lacht Heinrich. „Weil sie mehr ist als ein Sinnbild. Sie steht über dem Kaiser. Nicht ihm zu Ehren – sondern dem Volk zur Mahnung. Sie ist unsere Wächterin. Nicht über den Sieg, sondern über den Bund.” „Ein Denkmal kann man nicht aus Gedanken meißeln”, sagt Heinrich, als er die ersten Zeitungen des neuen Jahres durchblättert. „Es braucht auch: Geld”, stimmt Friedrich zu. „Und da kommt es auf alle an.” Er sitzt im kleinen Lesezimmer des Veteranenvereins in Wiesbaden, der Ofen knistert, draußen rieselt stiller Schnee. Seit Monaten sammeln sich Stimmen, Artikel, Skizzen und Vorschläge zur Idee des Denkmals über dem Rhein. Doch so erhaben der Gedanke ist – er verlangt nach Mitteln, nach Organisation, nach Taten. Die Fahne des Veteranenvereins weht flatternd im Wind, als Friedrich und Heinrich sie an jenem Morgen im März 1872 durch die Gassen Wiesbadens tragen. In ihren Händen halten sie die Sammelbüchsen wie einst das Gewehr – mit Stolz und Ziel. „So können wir auch Jahre nach unserer letzten Schlacht wieder etwas beitragen”, sagt Friedrich, als der Vorstand des Vereins von der Spendenaktion erfährt. „Wir kämpfen nicht mehr mit Waffen. Aber wir können helfen, das Gedächtnis zu formen.” Heinrich, zuerst skeptisch, ist rasch dabei. „Wenigstens wird diesmal keiner angeschrien, wenn er zu langsam marschiert”, witzelt er, während er die Sammellisten ordnet. Sie gehen von Tür zu Tür. Apotheken. Schusterläden. Weinschenken. Sie bitten nicht mit Zwang, sondern mit Würde. „Für das Denkmal der Einheit”, sagen sie. Oder: „Für die Germania, die über uns wachen soll.” Manche öffnen die Tür nur einen Spalt, schauen misstrauisch, geben dann doch einen Groschen. Andere bitten sie herein, stellen ihnen ein Glas auf den Tisch, erzählen von Brüdern im Krieg, von verlorenen Vätern, von Hoffnungen, die in Versailles aufgeblüht sind. In einem kleinen Tabakladen in der Schwalbacher Straße drückt eine alte Frau Friedrich zwei silberne Groschen in die Hand. „Für meinen Mann”, sagt sie. „Er ist nicht mehr zurückgekommen. Aber vielleicht sieht er von oben, dass es nicht umsonst war.” Friedrich verneigt sich leicht. Mehr kann er nicht tun. Im Vereinslokal zählen sie abends das Geld: Taler, Groschen, Kreuzer, Kupferpfennige. Die Liste wächst. „Keiner gibt viel”, sagt Heinrich, während er die Münzen in Leinentücher rollt, „aber alle geben.” „Das ist es, was zählt”, sagt Friedrich. „Nicht die Größe der Gabe, sondern die Größe des Willens.” Die Jüngeren im Verein, kaum zwanzig, schauen ihnen zu – still, fast ehrfürchtig. Sie haben den Krieg nicht mehr miterlebt, nur das Reich geerbt. Nun sehen sie, wie auch alte Soldaten noch einmal marschieren – nicht über Felder, sondern durch das Gedächtnis des Volkes. Als sie am Sonntag auf dem Vereinsplatz die Sammelurkunde dem Komitee überreichen, stehen sie in Reih und Glied. Ihre Uniformen sind alt, die Knöpfe stumpf, die Hände vom Leben gezeichnet – aber ihre Haltung ist gerade. Friedrich tritt vor, reicht das Dokument. Dann sagt er mit ruhiger Stimme: „Dieses Denkmal ist nicht nur für Kaiser und Sieger. Es ist für uns alle. Für das, was wir geglaubt haben – und immer noch glauben. Dass dieses Land eins ist. Und bleibt.”
5. Wer ist Germania
Februar 1872

Es ist spät geworden in der Werkstatt. Nur eine einzelne Öllampe wirft ihr flackerndes Licht auf den Tonentwurf, den Schilling mit einem feinen Werkzeug bearbeitet. Die Züge der Figur sind fast fertig. Und doch wirkt sie noch leblos. Als fehle nicht Ton, sondern etwas Tieferes: Sinn. Friedrich sitzt auf einem Schemel in der Ecke. Schweigend, mit den Händen im Schoß. Dann fragt er plötzlich: „Sag, Johannes – wer ist sie eigentlich?” Schilling blickt auf. „Germania?” Friedrich nickt. Der Bildhauer legt das Werkzeug zur Seite, wischt sich die Hände an einem Leinentuch ab und tritt neben die Statue. Einen Moment sagt er nichts. Dann beginnt er: „Germania ist keine Frau. Und keine Göttin. Sie ist eine Idee.” „Aber wessen Idee?”, fragt Friedrich. „Die des Römers.” Friedrich runzelt die Stirn. Schilling lächelt matt. „Tacitus. Im ersten Jahrhundert nach Christus. Er schrieb über die Germanen – wild, freiheitsliebend, unzivilisiert. Aber im selben Atemzug bewunderte er sie. Ihre Treue. Ihren Mut. Ihre Einfachheit. Germania ist bei ihm das Sinnbild für ein Land, das nie ganz gezähmt werden kann.” Friedrich nickt langsam. „Ein Fremder sieht uns – und erfindet uns.” „Das eigene Innere und Wesen zu verstehen gelingt erst durch ein Gegenüber – durch den Vergleich”, sagt Schilling. „So ist es oft mit Mythen. Und mit Nationen.” Im Laufe der Jahrhunderte tauchte die Figur der Germania immer wieder auf – auf Siegeln, Gemälden, Flugblättern. Mal als stolze Schildmaid, mal als trauernde Mutter, mal als kämpfende Jungfrau mit wehender Fahne. Man malte sie in Rüstung, in Toga, in Tracht. Doch immer trägt sie etwas, das sich nicht abstreifen lässt: eine Sehnsucht. „Sie ist nicht der Staat”, sagt Schilling leise. „Sie ist das Gewissen.” „Und was soll sie in deinem Werk sein?”, fragt Friedrich. „Eine Mahnerin. Eine Wächterin über das, was wir errungen haben. Sie soll nicht herrschen – sondern erinnern. Daran, was Einheit kostet. Und was sie wert ist.” Friedrich tritt näher an die Statue. Ihre Stirn ist ruhig. Ihre Haltung aufrecht. In der einen Hand hält sie das Schwert, in der anderen die Kaiserkrone – nicht überheblich, sondern wie ein feierliches Zeichen. Zu ihren Füßen liegt ein Eichenkranz, Symbol deutscher Standhaftigkeit. In den Falten ihres Gewandes wirkt sie nicht wie eine Siegerin, sondern wie eine Hüterin. „Sie sieht mich an”, flüstert Friedrich. „Nicht mit Stolz – sondern mit Verantwortung.” Schilling nickt. „Germania ist das, was wir von Deutschland erhoffen. Und das, was wir bewahren müssen.” Im Februar 1872 beginnt die nächste Phase: Ein Wettbewerb wird ausgeschrieben – offen für Künstler, Bildhauer, Architekten aus dem ganzen Reich. Der Siegerentwurf soll nicht nur technisch realisierbar sein, sondern eine Idee atmen: die Seele der deutschen Einheit. Die Spannung ist groß. In Ateliers von München bis Weimar wird gezeichnet, geknetet, modelliert. Entwürfe treffen ein – viele, prachtvoll, schwer. Germania mit Schwert. Germania mit Lorbeer. Germania auf einem Thron, auf einem Pferd, mit Flügeln, mit Krone, mit Fahne. Aber als das Komitee im Mai zusammenkommt, bleibt die Begeisterung aus. Keiner der Vorschläge überzeugt. Zu pathetisch. Zu martialisch. Zu kleinlich. Zu roh. Die Entscheidung fällt schwer. „Wenn wir es tun”, sagt ein Kommissionsmitglied, „dann richtig. Oder gar nicht.” Doch das Projekt gerät nicht ins Wanken. Eine zweite Ausschreibung wird vorbereitet – diesmal gezielter. Erfahrene Künstler werden direkt eingeladen. Und unter ihnen ist einer, der schon lange mit einer klaren Vorstellung arbeitet: Johannes Schilling aus Dresden. Als das Gremium seine ersten Skizzen sieht, halten die Honoratioren den Atem an. Da ist sie: Germania. Nicht übertrieben. Nicht bescheiden. Aufrecht. Wach. Eine Krone aus Eichenlaub. In der rechten Hand das Kaiser-Schwert, in der linken die Reichskrone, erhoben, aber nicht triumphierend, sondern feierlich. Zu ihren Füßen: das deutsche Volk, die Geschichte, der Rhein. Sinnbild und Sinngeberin zugleich. Die Wahl fällt einstimmig. „Das ist sie”, sagt Friedrich. „So stelle ich mir ein Denkmal vor, das über uns hinausreicht.”
6. Die Wacht am Rhein
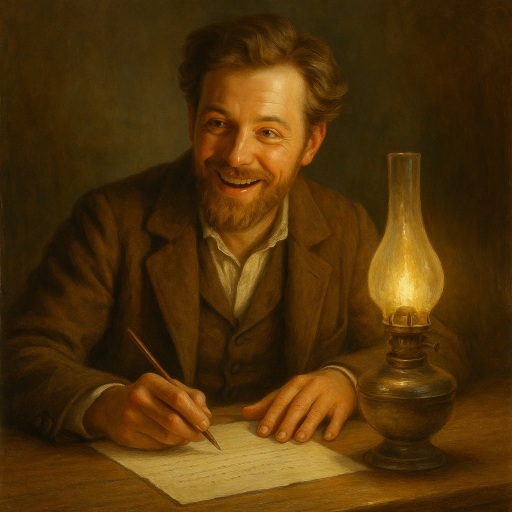
Der Wind weht warm vom Fluss herauf, als Friedrich an diesem Abend auf dem Niederwald steht. Unten fließt der Rhein seit Millionen von Jahren. In seinem leisen Murmeln glaubt er Stimmen zu hören, vergangene, verhallte, doch nicht vergessene. Er erinnert sich an das erste Mal, als er das Lied hörte. Es war 1840 gewesen. In einem engen Gastraum in Mainz, kaum beleuchtet, voller Rauch und Hoffnung. Ein junger Mann erhob sich und begann zu singen, zuerst leise, dann immer kräftiger:
„Es braust ein Ruf wie Donnerhall,
wie Schwertgeklirr und Wogenprall –
zum Rhein, zum Rhein, zum deutschen Rhein,
wer will des Stromes Hüter sein?”
Damals war Friedrich kaum zwanzig. Das Lied packte ihn wie ein Marschbefehl ans Herz. Es war mehr als Melodie, es war ein Versprechen. Und doch entstand es ursprünglich aus Furcht. Im Jahr 1840 erhob Frankreich, wieder einmal, Anspruch auf den Rhein. Der französische Premierminister Thiers fabulierte von einer „natürlichen Grenze”. Die Rheingrenze, für viele Deutsche ein Schreckgespenst, ein Echo der napoleonischen Zeit. Ein Lehrer aus Barmen, Max Schneckenburger, schrieb daraufhin die Verse. Kein Berufsdichter, sondern ein Mann mit klarem Blick und aufrechter Seele. Seine Zeilen fordern keine Rache, sondern Standhaftigkeit. Keine Eroberung, sondern Verteidigung. Erst 1854, Jahre nach Schneckenburgers Tod, vertonte Carl Wilhelm das Gedicht. Die Melodie, marschartig aber mit Herz, entfaltete eine gewaltige Wirkung. Das Lied ging durchs Land wie ein Lauffeuer. Männer sangen es in Kneipen, Studenten auf Umzügen, Soldaten in Manöverpausen. Und mit dem Krieg von 1870 gegen Frankreich wurde es zum Symbol: der deutsche Rhein, unantastbar.
„So lang ein Tropfen Blut noch glüht,
noch eine Faust den Degen zieht
und noch ein Arm die Büchse spannt,
betritt kein Feind hier deinen Strand.”
Friedrich spricht die Zeilen im Stillen mit. Er ist nicht mehr jung, nicht mehr kampflustig. Doch das Lied brannte sich in sein Herz, nicht als Kriegslied, sondern als Schutzlied. Nicht aus Hass, sondern aus Sorge. Wie die Germania auf dem Niederwald steht auch dieses Lied für eine Haltung: Wachsamkeit. Zusammenhalt. Bereitschaft. Es ist kein Zufall, dass bei den ersten Skizzen zum Denkmal oft die Zeile zitiert wurde: „Die Wacht am Rhein.” Sie meißelte sich in das deutsche Bewusstsein ein wie in Stein. Heinrich tritt neben ihn. Auch er schweigt eine Weile. Dann fragt er: „Meinst du, sie singen es noch in hundert Jahren?” Friedrich lächelt schwach. „Wenn sie den Fluss noch lieben, ja.”
7. Einweihung

Die Menge strömt über die Wege des Niederwalds. Männer in Uniform, Frauen mit Hüten, Kinder auf den Schultern der Väter. Es riecht nach feuchtem Laub, Wurstbrot und einem Hauch von festlicher Aufregung. Über den Reben liegt ein Dunst, doch über dem Rhein hängt die Sonne klar. Friedrich steht in der ersten Reihe, dicht an Heinrichs Seite. Seine Hände zittern leicht – nicht vor Kälte, sondern vor Bedeutung. Achtunddreißig Jahre sind vergangen, seit er durch die Gassen von Frankfurt das Flugblatt mit „Freiheit für Deutschland” verteilt hat. Nun blickt er auf ein Monument, das größer ist als alles, was er je zu hoffen gewagt hatte. Germania erhebt sich über dem Rhein, mächtig, ruhig, aufrecht. Ihre Krone glänzt in der Vormittagssonne. Das Schwert ruht in der Hand, nicht erhoben, sondern präsent. Und doch ist es nicht das Metall, das Eindruck macht – sondern die Stille, mit der sie steht. Keine Pose, kein Triumph. Nur Wache. Ein Blechbläserchor spielt. „Heil dir im Siegerkranz.” Dann die Nationalhymne. Die Menschen erheben sich. Uniformen werden gerichtet. Taschentücher tupfen Augen. Auch Friedrichs Blick ist feucht, doch er wischt sich nicht ab. Dann tritt der Kaiser Wilhelm I. an das Podium. „Deutsche Brüder! Heute stehen wir hier geeint im Geiste, im Blute, in der Geschichte. Was Jahrhunderte lang zersplittert war, ist nun zusammengefügt. Was einst in Herzogtümern, Markgrafschaften und freien Städten auseinanderstrebte, schlägt nun in einem gemeinsamen Herzen: dem Deutschen Reich. Ich blicke zurück auf ein Volk, das aus Sachsen, Bayern, Schwaben, Friesen, Hessen und Preußen bestand – stolz, eigenständig, mit festem Willen. Jeder Stamm bewahrte seine Eigenart, seine Zunge, seinen Brauch und doch, so verschieden sie waren, so einig sind sie heute im Schicksal! Die Einheit der deutschen Stämme ist nicht das Werk eines Tages, nicht das Ergebnis einer Feder oder eines Beschlusses – sie ist das Ergebnis jahrhundertelanger Prüfungen, durchlitten in Feuer und Eisen, getragen von Treue, Mut und Opferbereitschaft. Von der Völkerschlacht bei Leipzig bis zu den Flammen von Sedan, von den Freiheitskriegen gegen Napoleon bis nach Versailles. Es war das deutsche Volk selbst, das seine Einheit errang, durch Willen, durch Blut, durch Geist. Diese Einheit sie ist uns durch die Werke unserer Ahnen gegeben, aber sie ist uns auch aufgegeben! Wir müssen sie pflegen wie ein heil’ges Gut, schützen vor Zwietracht, bewahren vor Verweichlichung. In der Vielfalt unserer Stämme liegt unsere Kraft, doch in ihrem Bund liegt unsere Bestimmung. Lasst uns nicht vergessen: Der Rhein trennt uns nicht er verbindet uns. Die Elbe fließt nicht für einen Stamm, sie trägt das Lied aller Deutschen. Und von den Alpen bis zur Nordsee soll gelten, was ich hier mit fester Stimme spreche: Ein Volk. Ein Reich. Ein Kaiser. Möge Gott uns beistehen, dass dieses Reich Bestand habe in Einigkeit, in Recht, in Treue. Es lebe das deutsche Vaterland!” Weitere Redner treten ans Podium. Worte von Dank, von Ehre, von deutscher Geschichte. Botho zu Eulenburg tritt vor, verliest die Entstehungsgeschichte. Dann wird der Name genannt, den nun alle mit einem Nicken empfangen: Johannes Schilling. Der Bildhauer tritt an das Podest. Er spricht nicht lange. Er zeigt auf die Statue. Und sagt: „Sie ist nicht für mich. Nicht für Sie. Sie ist für das, was kommen wird. Damit niemand vergisst, was uns verbindet.” Beifall brandet auf. Friedrich legt seine Hand auf Heinrichs Schulter. „Das ist es, Heinrich. Nicht ein Denkmal für den Krieg. Für das Leben.” Heinrich sagt nichts. Aber seine Hand umfasst Friedrichs Hand fest. Die Kinder am Rand des Platzes rufen „Germania!”, ohne zu wissen, wer sie ist. Und doch haben sie begriffen, dass sie etwas bedeutet. Etwas Dauerhaftes. Etwas, das bleibt, wenn die Stimmen verstummen. Als die Feier sich auflöst, tritt Friedrich ein letztes Mal vor die Statue. Er blickt hinauf. „Du stehst nicht über uns”, flüstert er. „Du stehst mit uns.” Dann dreht er sich um. Und geht den Hügel hinab. Dem Rhein entgegen.